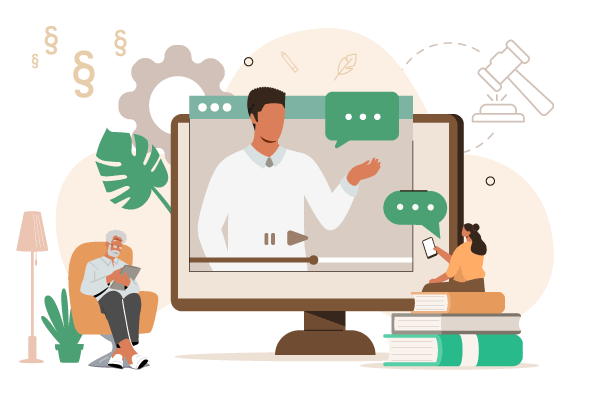Pflegebedürftige benötigen häufig nicht nur klassische Pflege, sondern auch Unterstützung bei den vielen organisatorischen Aufgaben des Alltags. Bankgeschäfte, Behördengänge, das Begleichen von Rechnungen, die Kommunikation mit der Kranken- und Pflegeversicherung, das Treffen von gesundheitlichen Entscheidungen und vieles mehr müssen regelmäßig erledigt werden – und dies wird immer mehr zur Hürde.
Solange Pflegebedürftige das größtenteils allein schaffen, dürfen Angehörige ruhig ein wenig Hilfestellung leisten. Doch sie dürfen laut deutschem Recht nicht einfach so Aufgaben komplett übernehmen. Das wäre ein unerlaubter Eingriff ins Selbstbestimmungsrecht.
Um Angehörigen im Alltag organisatorische Aufgaben oder Entscheidungen abnehmen zu dürfen, brauchen Sie eine offizielle Erlaubnis. Das kann wahlweise eine Vorsorgevollmacht oder eine rechtliche Betreuung sein. Viele machen sich darüber zunächst keine Gedanken. Doch im Ernstfall dürfen etwa Bankmitarbeitende oder Ärztinnen und Ärzte weder Auskunft geben noch eine Anweisung ausführen, wenn es keine schriftliche Erlaubnis von der betroffenen Person gibt. Viele scheinbar kleine Organisationstätigkeiten gelten als „Rechtsgeschäfte“. Um nicht plötzlich in der Situation zu sein, dass man gerne helfen würde, es aber nicht darf, ist es sinnvoll, sich rechtzeitig Gedanken zu machen: Welche Form der rechtlichen Vertretung wollen wir?
Die Vorsorgevollmacht
Die einfachste Lösung für dieses Problem ist oftmals eine Vorsorgevollmacht. Darin legt die Vollmachtgeberin oder der Vollmachtgeber fest, wer welche Aufgaben für sie oder ihn übernehmen darf. Typische Lebensbereiche sind Gesundheit und Pflege, Wohnen, Behörden, Finanzen, Versicherungen sowie Kommunikation. Wenn Ehepartner sich gegenseitig bevollmächtigen und zusätzlich je eine Vollmacht, zum Beispiel für ein erwachsenes Kind, ausstellen, dann stehen jeweils zwei Personen als Back-up bereit. Statt einer umfassenden Vollmacht ist es auch möglich, lediglich Teilvollmachten an eine oder mehrere Personen zu vergeben.
Lange Zeit konnten Ehepartner nicht einmal in gesundheitlich kritischen Situationen für den anderen entscheiden. Das hat der Gesetzgeber zum 1. Januar 2023 geändert. Nun gilt ein sogenanntes Notvertretungsrecht nach § 1358 BGB, sodass Ehepartner und eingetragene Lebenspartner lebensnotwendige gesundheitliche Entscheidungen für die andere Person treffen können, sofern diese sich nicht äußern kann, weil sie beispielsweise im Koma liegt. Die Grenzen sind jedoch sehr eng gesteckt. In allen alltagstypischen Situationen dürfen Ehepartner ohne schriftliche Erlaubnis offiziell nichts für den oder die andere übernehmen.
Eine Vollmacht ist in der Regel sofort gültig, bis sie widerrufen wird. Man sollte sie in ihrer aktuell gültigen Fassung der bevollmächtigten Person übergeben. Veraltete Vollmachten sollte man vernichten. Es ist sinnvoll, die wichtigsten Informationen zur Vollmacht außerdem beim Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer zu registrieren. Dort können beispielsweise Krankenhäuser schnell und unkompliziert nachfragen, ob und für wen eine Vollmacht vorliegt, wenn das nötig sein sollte.
Gut zu wissen: Der mündlich geäußerte Wille hat immer Vorrang vor einer schriftlichen Vollmacht.
Eine kostenlose Vorlage für eine Vorsorgevollmacht können Sie sich beim Bundesministerium der Justiz herunterladen. Ein kostenpflichtiges Vorsorge-Set, in dem mehrere Vorlagen, unter anderem für eine Vorsorgevollmacht und ein Testament, samt ausführlicher Erklärungen enthalten sind, gibt es beispielsweise bei der Stiftung Warentest zu kaufen. Beide verlinkten Vorlagen sind juristisch geprüft.

Kostenloses E-Paper: Rechtliche Vorsorge
Planen, verfügen, bestimmen – wir haben Ihnen alles Wichtige zur rechtlichen Vorsorge in einem E-Paper gebündelt.
Rechtliche Betreuung und Betreuungsverfügung
Wer keine Vollmacht ausstellen möchte oder das nicht mehr kann, etwa weil eine Demenz bereits weit fortgeschritten ist, hat noch eine weitere Möglichkeit, sich vertreten zu lassen: die rechtliche Betreuung. Manchmal wird auch von „gesetzlicher Betreuung“ gesprochen. Beides meint: In einem gesetzlich festgelegten Verfahren wird vor einem Betreuungsgericht eine Vertretungsperson festgelegt, die Aufgaben in bestimmten Lebensbereichen übernehmen darf. Das soll im Idealfall eine vertraute Person wie ein erwachsenes Kind, der Partner oder eine gute Freundin sein. Dann spricht man von einer ehrenamtlichen Betreuung. Es gibt auch Ehrenamtliche, die für Fremde eine rechtliche Betreuung übernehmen, weil sie sich gesellschaftlich engagieren wollen. In jedem Fall prüft das Gericht regelmäßig, ob die Betreuerin oder der Betreuer ordentlich arbeitet und stets im Sinne der betreuten Person handelt. Dazu sind Betreuende nämlich gesetzlich verpflichtet.
Auf Wunsch kann das Gericht auch eine haupt- oder nebenberufliche Betreuungsperson ernennen. Das sind dann zum Beispiel Juristinnen und Juristen, Sozialarbeiterinnen und -arbeiter oder Verwaltungsfachangestellte mit einer Zusatzausbildung, die sich etwa mit Behördenangelegenheiten oder Finanzen besonders gut auskennen. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn es keine erwachsenen Kinder gibt, wenn diese nicht alle nötigen Aufgaben übernehmen wollen oder können oder wenn die betreute Person besondere Probleme hat, also beispielsweise süchtig oder verschuldet ist. In solchen Fällen ist eine rechtliche Betreuung durch einen Profi oft besser als eine Vollmacht oder eine ehrenamtliche Betreuung. Auch wenn die Familie zerstritten ist, kann es sinnvoll sein, dass eine außenstehende Betreuungsperson die nötigen Aufgaben übernimmt.
Ein Nachteil ist, dass Berufsbetreuerinnen und -betreuer sowie auch das Gericht bezahlt werden müssen. Die Beträge sind pauschal festgelegt und vergleichsweise gering, aber schmälern dennoch das Vermögen. Nur wer kaum Vermögen hat, für den übernimmt der Staat die Kosten. Ein weiterer Nachteil ist, dass ein Betreuungsverfahren eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Wenn man schnell und unkompliziert Hilfe haben möchte, ist eine rechtzeitig vorbereitete Vollmacht oft der praktischere Weg.
Irgendeine Form von rechtlicher Vertretung wird früher oder später für fast alle Pflegebedürftigen notwendig. Es ist daher sinnvoll, sich frühzeitig Gedanken darüber zu machen, was man sich vorstellen kann. Durch das Aufsetzen einer umfassenden Vorsorgevollmacht lässt sich ein Betreuungsverfahren und somit eine rechtliche Betreuung vermeiden.
Betreuungsverfügung
Wer keine Vollmacht ausstellen, aber dennoch mitbestimmen möchte, wer später vom Gericht zur Betreuungsperson ernannt werden darf, kann eine sogenannte Betreuungsverfügung aufsetzen. Darin werden Wünsche notiert, etwa wer eine Betreuung, sofern nötig, möglichst übernehmen soll oder wer auf keinen Fall ernannt werden darf. Auch eigene Wertvorstellungen und Lebenswünsche können notiert werden. Falls später eine fremde Betreuungsperson bestimmt wird, hat diese ein paar Hinweise, was dem betroffenen Menschen im Leben wichtig war und ist. Das Gericht muss sich an die notierten Wünsche und Werte halten, sofern diese nicht gesetzeswidrig oder völlig abwegig sind. Auch für eine Betreuungsverfügung gibt es Vorlagen im Internet und in Vorsorge-Sets.
Betreuungsvereine
Wer (vielleicht) eine Betreuung übernehmen möchte oder eine Vollmacht erhält, kann sich kostenlos beraten lassen, was zu beachten ist. Das ist möglich bei örtlichen Betreuungsvereinen, die staatlich finanziert werden. Auch Interessierte können sich dorthin wenden, wenn sie beispielsweise selbst eine Vollmacht oder eine Verfügung aufsetzen wollen. Leider gibt es keine Datenbank, um den zuständigen Betreuungsverein zu finden. Man muss nach „Betreuungsverein Wohnort“ im Internet suchen oder beim örtlichen Amtsgericht nachfragen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Betreuungsvereinen können auch beim Ausfüllen von Formularen oder Vollmachten helfen. Und sie beraten, welche Variante im konkreten Fall die geschicktere ist. Wer möchte, kann sich auch – natürlich unter Einhaltung einer gewissen Diskretion – mit anderen privaten Betreuern über Erfahrungen austauschen.
Patientenverfügung
Im gleichen Atemzug mit Vollmachten und Betreuungen wird auch oft die Patientenverfügung genannt. Sie ersetzt keine der beiden Varianten, kann aber als Ergänzung sinnvoll sein. In einer Patientenverfügung werden Wünsche zu medizinischen Behandlungen festgelegt. Sie wird benötigt, wenn sich jemand beispielsweise nach einem Unfall nicht mehr äußern kann, welche Untersuchungen und Behandlungen er oder sie sich wünscht. Will man beatmet oder künstlich ernährt werden? Oder lieber nur vom Schmerz befreit? Möchte man die Möglichkeit zur letzten Beichte haben? Wer soll, wenn möglich, am Sterbebett sitzen? All solche Fragen lassen sich in einer Patientenverfügung beantworten und müssen dann – sofern irgendwie möglich – umgesetzt werden.
Gerade für Menschen mit chronischen Erkrankungen und/oder einer Pflegebedürftigkeit kann eine Patientenverfügung sinnvoll sein. Sehr wichtig ist, dass alle Formulierungen sehr eindeutig sind. Eine gute Beratung ist für die Erstellung daher dringend angeraten. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel auf der Website des Bundesjustizministeriums oder bei den Verbraucherzentralen.