Um Leistungen von der Pflegeversicherung zu erhalten, muss zuvor ein Pflegegrad festgelegt werden. Er weist nach, dass jemand pflegebedürftig ist und wie viel Pflege benötigt wird. Davon hängt die Höhe der Leistungen ab.
Im deutschen System gibt es 5 Pflegegrade. Pflegegrad 1 bedeutet nur leichten Pflegebedarf. Pflegegrad 5 heißt, dass eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung einer sehr stark pflegebedürftigen Person notwendig ist. Die Pflegegrade und der Weg dorthin sind für alle Menschen gleich – egal ob gesetzlich oder privat pflegeversichert.

Eine Pflegeversicherung ist in Deutschland Pflicht. Wer gesetzlich krankenversichert ist, zahlt in der Regel auch automatisch in die gesetzliche Pflegeversicherung ein.
Privat Krankenversicherte müssen eine private Pflegeversicherung abschließen. Das ist nicht zu verwechseln mit einer privaten Zusatzversicherung wie zum Beispiel einer Pflegetagegeld-Versicherung. Die private Pflegepflichtversicherung zahlt das Gleiche wie die gesetzliche Versicherung und ist für alle privat Krankenversicherten verpflichtend.
Eine Pflegezusatzversicherung darf jede Person zusätzlich abschließen. Sie bringt Extraleistungen.
Wie beantragen Sie einen Pflegegrad?
Um einen Pflegegrad zu erhalten, müssen Sie einen Pflegegrad bei der eigenen Pflegeversicherung beantragen. Die gesetzliche Pflegekasse ist an die Krankenkasse angegliedert. Wer also zum Beispiel bei der TK, bei der Barmer oder einer AOK krankenversichert ist, der ist auch dort pflegeversichert. Allerdings sind für den Pflegebereich andere Mitarbeitende zuständig als für den Krankheitsbereich. Ebenso werden die Pflegeleistungen aus einem anderen Topf bezahlt als die Leistungen im Krankheitsfall.
Pflegegrad beantragen – Schritt 1: Antrag stellen
Einen Antrag können Betroffene formlos schriftlich stellen, zum Beispiel so:
Ich, Maria Schmidt, geboren am 5.4.1948, wohnhaft in der Schillerstraße 12, 50858 Köln, stelle hiermit einen Antrag auf Leistungen aus der Pflegeversicherung.
Datum, Unterschrift
Das Datum ist wichtig, da die Versicherung später rückwirkend ab der Antragstellung zahlt. Wer die Adresse der eigenen Pflegekasse nicht kennt, kann bei der Krankenkasse nachfragen.
Pflegegrad beantragen – Schritt 2: Fragebogen ausfüllen
Nach Antragstellung schickt die Versicherung einen mehrseitigen, hausinternen Fragebogen zu, der ausgefüllt und zurückgeschickt werden muss. Dabei können Sie sich beim örtlichen Pflegestützpunkt helfen lassen. Wer manche Fragen noch nicht beantworten kann, darf Details auch nachreichen.
Wichtig zu wissen ist: Beim Ausfüllen dürfen Angehörige und Beratungspersonen zwar helfen. Doch unterschreiben muss die Person, die den Antrag stellt. Eine fremde Unterschrift ist nur mit einer entsprechenden Vollmacht oder rechtlicher Betreuung gültig.
Wollen Privatversicherte einen Pflegegrad beantragen, müssen sie sich an ihre Pflegepflichtversicherung wenden (s. o.). Details erläutert auch die Compass private Pflegeberatung unter der kostenlosen Rufnummer 08 00 / 101 88 00.
Pflegegrad beantragen – Schritt 3: Antrag prüfen lassen
Ist der Antrag eingegangen, überprüft die Versicherung, ob ein Anspruch auf Pflegeleistungen besteht. Das ist der Fall, wenn jemand voraussichtlich für mindestens sechs Monate regelmäßig Hilfe im Alltag brauchen wird. Außerdem müssen diejenigen, die den Pflegegrad beantragen, in den vergangenen zehn Jahren mindestens 24 Monate lang in die Pflegeversicherung eingezahlt haben oder familienversichert gewesen sein.
Pflegegrad beantragen – Schritt 4: Begutachtungstermin vereinbaren
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, vereinbart eine Fachkraft vom Medizinischen Dienst (für gesetzlich Versicherte) oder von Medicproof (für privat Versicherte) einen Besuchstermin mit der Person, die den Pflegegrad beantragt hat.
Seit der Corona-Pandemie führt der Medizinische Dienst (MD) Höherstufungs- und Wiederholungsbegutachtungen unter bestimmten Voraussetzungen (Kapitel 6.1.2 der Begutachtungsrichtlinien des MD) aber auch per Telefon- oder Videointerview durch. Für Erstbegutachtungen oder im Fall eines Widerspruchs ist diese Option allerdings ausgeschlossen.
Bei diesem Termin wird begutachtet, ob eine Pflegebedürftigkeit vorliegt. Dafür werden viele Fragen gestellt und einige Fähigkeiten überprüft. Beispielsweise erkundigen sich die Gutachterinnen und Gutachter nach dem üblichen Alltag und bitten die Antragstellenden, ein Glas Wasser einzuschenken oder eine Treppe hochzusteigen. Auch Fragen zu Erkrankungen werden gestellt.

Der Fragen- und Aufgabenkatalog ist für alle gleich und soll ermitteln, welche Hilfe im Alltag nötig ist. Die begutachtende Fachkraft ist zur Neutralität verpflichtet und keinen Weisungen der Versicherung unterstellt. Angehörige sollten, wenn möglich, bei diesem Termin dabei sein.
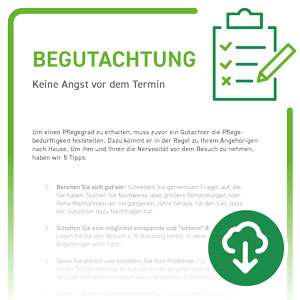
5 Tipps für den Termin mit dem Gutachter
Wie Sie die Begutachtung gut vorbereiten und weniger nervös sind.
Wie wird der Pflegegrad festgelegt?
Nach dem Besuch lässt die Fachkraft der Pflegeversicherung ihre Eindrücke zukommen. Im Bericht werden Punkte für verschiedene Schwierigkeiten vergeben. Je höher die Punktzahl ausfällt, desto mehr Hilfe ist nötig. Bei 12 Punkten oder weniger liegt keine Pflegebedürftigkeit im Sinne des Gesetzes vor. Bei einer Punktzahl zwischen 12,5 und 100 wird ein Pflegegrad festgelegt. Dieser gilt zeitlich unbegrenzt.
Wichtiger Hinweis: Sie können jederzeit eine erneute Begutachtung beantragen. Allerdings gibt es dabei keinen Bestandsschutz. Wer also einen Neuantrag stellt, sollte sich sicher sein, ein „besseres“ Ergebnis zu erzielen. Andernfalls sollten Sie alles so belassen wie gehabt. Denn: Ein Pflegegrad verfällt nicht.
Was bedeuten die Pflegegrade 1 bis 5?
Es gibt im deutschen System einen wichtigen Unterschied zwischen dem Pflegegrad 1 und den Pflegegraden 2 bis 5: Mit Grad 1 gibt es nur Basisleistungen der Pflegeversicherung. Ab Pflegegrad 2 können sämtliche Leistungen genutzt werden. Lediglich die Maximalsätze steigen von Grad 2 bis 5 an. Über die verschiedenen Leistungen muss der Gutachter oder die Gutachterin aufklären.
Die begutachtende Fachkraft vergibt bei ihrem Besuch nicht nur einen Punktwert. Sie ist auch verpflichtet, über das System der Pflegegrade sowie Hilfsmittel, Präventivmaßnahmen, mögliche Rehamaßnahmen und Umbauten zu informieren.
So können zum Beispiel technische Hilfsmittel wie Rollatoren oder Pflegebetten häufig ausgeliehen oder von der Pflegeversicherung bezuschusst werden. Wer möchte, kann mit dem Gutachten direkt einen Antrag auf solche Hilfsmittel stellen. Sie werden in aller Regel automatisch mitbewilligt.
Für Hilfsmittel zum Verbrauch, wie etwa Einmalhandschuhe, Schutzmasken oder Bettschutzeinlagen, gibt es einen Monatszuschuss.
Für nötige Umbauten des Zuhauses gewährt die Pflegeversicherung einen Zuschuss in Höhe von derzeit 4.180 Euro (pro Umbaumaßnahme).
Reha- oder Präventivmaßnahmen können helfen, den Alltag besser zu gestalten oder eine Verschlechterung des aktuellen Zustands hinauszuzögern.
Wann wissen Sie, welchen Pflegegrad Sie erhalten?
Zwischen Antragstellung und Gutachterbesuch dürfen maximal fünf Wochen vergehen. Die Versicherung muss das Ergebnis dann binnen weniger Tage mitteilen. Ist eine schnelle Entscheidung notwendig, etwa weil jemand nach einem Unfall oder einer plötzlichen Erkrankung im Krankenhaus liegt und nun pflegebedürftig(er) ist, muss die Entscheidung über einen Pflegegrad innerhalb einer Woche fallen.
Wie legen Sie Widerspruch gegen einen Pflegegrad ein?
Wer mit dem Ergebnis der Begutachtung nicht einverstanden ist, kann Widerspruch einlegen. Dieser muss schriftlich an die Versicherung geschickt werden und dort innerhalb eines Monats nach Eintreffen Ihres Bescheids vorliegen. Das muss auch im Bescheid stehen. Sollten darin keine Informationen zum Widerspruch vermerkt sein, verlängert sich die Widerspruchsfrist auf ein Jahr.
Im Widerspruchsschreiben sollten Sie erläutern, warum Sie mit dem Ergebnis nicht einverstanden sind, und Gründe für eine andere Entscheidung oder eine erneute Begutachtung nennen. Ein ärztliches Attest oder ein Bericht einer Pflegefachkraft, falls bereits regelmäßig jemand kommt, sind dafür sehr hilfreich. Reicht die Widerspruchsfrist nicht aus, um Belege zu besorgen, weisen Sie im Widerspruchsschreiben darauf hin, dass Sie die Dokumente nachreichen werden.
Wenn Sie Hilfe oder Beratung brauchen, um einen Widerspruch zu verfassen, können Sie sich zum Beispiel an einen Sozialverband wie den Vdk oder den SoVD wenden.


