In Deutschland sind etwa 2,7 Millionen Menschen von chronischen Wunden betroffen. Eine Wunde, die nach acht Wochen nicht abgeheilt ist, wird als chronisch bezeichnet.
Wie entstehen chronische Wunden?
Zurückzuführen sind chronische Wunden auf bereits bestehende Grunderkrankungen. Diese Krankheiten führen einerseits dazu, dass Wunden schneller entstehen können als üblich – etwa bereits bei leichtem Druck auf die Haut –, andrerseits können die Grunderkrankungen auch die Abheilung der chronischen Wunden beeinträchtigen.
Zu den wichtigsten Krankheiten, die zu chronischen Wunden führen können, zählen:
- Die sogenannte „Schaufensterkrankheit“ (früher auch als „Raucherbein“ bekannt): Der medizinische Begriff lautet „periphere arterielle Verschlusskrankheit“ oder kurz PAVK. Hierbei kommt es aufgrund der verengten oder verschlossenen Arterien am Bein (deutlich seltener am Arm) zu Durchblutungsstörungen der Haut. Die Haut kann sich daher vor Wunden nicht mehr so gut schützen und diese auch nicht mehr so effektiv reparieren wie im Normalzustand.
- Krampfadern: In diesem Fall liegt eine sogenannte „venöse Insuffizienz“ vor. Das bedeutet, dass das Blut nicht mehr richtig abfließen kann und stattdessen im Gewebe versackt. Dies wiederum führt zu Schwellungen des Gewebes (Ödeme) und zu einer Verhärtung der Haut, die damit anfälliger für Wunden wird.
- Diabetes („Zuckerkrankheit“): Sie kann sich ähnlich wie Krampfadern auswirken. Die Durchblutung der Haut ist gestört und sie ist daher auch hier anfälliger für Wunden. Außerdem ist die Versorgung mit Sauerstoff und Immunzellen erschwert. Hinzu kommt bei Diabetes, dass die Nerven und damit auch das Schmerzempfinden gestört sein können, wodurch kleine Wunden nicht so schnell bemerkt und daher auch nicht so rasch wie möglich behandelt werden. Häufig ist bei Diabetes der Fuß von diesen Störungen betroffen, was als „diabetisches Fußsyndrom“ bekannt ist.
- Ein geschwächtes Immunsystem (etwa bei Krebs, Infektionen oder höherem Alter): Dieses kann die Heilung von Wunden ebenfalls beeinträchtigen. Denn die körpereigene Abwehr sorgt unter anderem dafür, dass bestimmte Zellen (die „weißen Blutkörperchen“) die Wunde reinigen und abgestorbenes Gewebe entfernen.
- Menschen, die viel liegen (müssen) oder im Rollstuhl sitzen: Sie sind aufgrund ihrer eingeschränkten Bewegungsfähigkeit häufiger von chronischen Wunden betroffen und auch öfter mangelernährt. Das fehlende Fettpolster unter der Haut kann dann zusammen mit dem konstanten Druck des eigenen Körpergewichts auf die Haut zu einem Dekubitus (umgangssprachlich als Druckgeschwür bezeichnet) führen.
Wie machen sich chronische Wunden bemerkbar?
Typische Beschwerden chronischer Wunden sind Schmerzen, die von der Größe oder Tiefe der Wunde abhängig sind. Häufig liegt auch ein quälender Juckreiz vor, der vor allem nachts auftritt und damit den Schlaf stören kann. Chronische Wunden sind außerdem wegen der fehlenden Heilung grundsätzlich „offene“ Wunden, sie haben einen unangenehmen Geruch, können nässen und zu rötlich-bräunlichen Verfärbungen rund um die Wunde führen.
Zudem kann bei solchen Wunden, vor allem am Bein, auch die körperliche Mobilität stark eingeschränkt sein. Zusätzlich können Bakterien relativ leicht in chronische offene Wunden eindringen, dort zu einer Entzündung führen oder sogar dafür sorgen, dass das Gewebe letztlich abstirbt. In schlimmen Fällen ist dann eine Amputation etwa des Fußes erforderlich oder die Bakterien breiten sich im ganzen Körper aus und führen zu einer lebensbedrohlichen Sepsis (Blutvergiftung).
Die eben beschriebenen Symptome wirken sich aber nicht nur auf den Körper aus. Schmerzen, Juckreiz und Geruch sind auch seelisch für Betroffene und deren Angehörige sehr belastend. So ziehen sich viele aus Angst, unangenehm aufzufallen, immer mehr zurück und isolieren sich von ihren Mitmenschen, können nicht mehr arbeiten und geraden zudem in finanzielle Nöte.
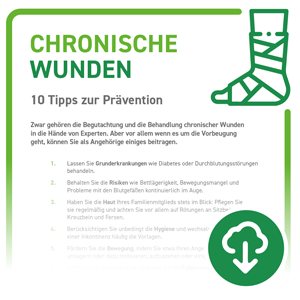
Präventions-Tipps für Ihren Pflegealltag
Sie können einiges tun, um chronischen Wunden vorzubeugen. Unsere 10 Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen.
Wie werden chronische Wunden behandelt?
Chronische Wunden sollten von erfahrenen Fachkräften behandelt werden. Diese professionelle Versorgung zielt darauf ab, die Wundheilung zu fördern und damit die Lebensqualität zu verbessern, aber auch bei bereits abgeheilten Wunden einen Rückfall – also eine neuerliche Wunde – zu verhindern. Welche Maßnahmen Wundexpertinnen und Wundexperten einsetzen, hängt von der Wunde ab: Wo am Körper befindet sie sich? Wie tief oder ausgebreitet ist sie? Wie ist der Gesundheitszustand des Patienten oder der Patientin? Wichtig zu wissen: Die Behandlung chronischer Wunden benötigt häufig viel Zeit. (Fachleute gehen von 90 bis 120 Tagen Behandlung und Versorgung bis zum Wundschluss aus.) In dieser Situation brauchen Betroffene und Angehörige viel Geduld!
Das Débridement
In manchen Fällen ist ein medizinischer Eingriff für die Behandlung chronischer Wunden notwendig. Dazu zählt z. B. das Débridement, auch “Wundtoilette“ genannt, wobei mittels Pinzette oder Skalpell sehr sorgsam die abgestorbenen Zellen beziehungsweise entzündetes Gewebe entfernt werden.
Es gibt auch noch eine Reihe weiterer Verfahren, die nicht zu Hause durchgeführt werden:
- Die Sauerstofftherapie: Sie basiert darauf, dass Wunden einen erhöhten Sauerstoffbedarf haben und die Zufuhr den Heilungsprozess anregt.
- Die „Vakuumversiegelungstherapie“: Hierbei wird die Wunde luftdicht abgedeckt und ein dünner Schlauch eingelegt, der die Wundflüssigkeit konstant absaugt. Der dadurch entstehende Unterdruck führt dazu, dass sie besser durchblutet wird.
Der Nutzen von Ultraschallwellen oder der Magnetfeldtherapie bei chronischen Wunden ist hingegen nicht bestätigt.
Was können Angehörige zu Hause tun?
Ergänzend zur professionellen Versorgung chronischer Wunden können Sie zu Hause dazu beitragen, die Wundheilung zu unterstützen. Empfohlen wird unter anderem, die Wunde mit einer Kochsalz- oder Elektrolytlösung rein zu halten, mit feuchten Kompressen, Folien oder auch Hydrogelen abzudecken und auf diese Weise zu schützen. Zudem können Sie den Juckreiz lindern und eine Austrocknung der Haut vermeiden: Das geht am besten mit einer Feuchtigkeitspflege, die sorgfältig auf den Wundrand und in der Wundumgebung aufgetragen wird. Achtung: Die Behandlung muss regelmäßig erfolgen.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Eine chronische Wunde ist sicher eine starke Belastung für Betroffene. Eine Heilung ist in vielen Fällen möglich, allerdings braucht es dafür Zeit und Geduld. Wichtig ist, dass Sie als pflegende Angehörige in Ihrem Alltag das Thema „chronische Wunden“ stets im Blick behalten und die Haut Ihres Angehörigen sorgfältig beobachten. Außerdem sollten Sie bei Auftreten einer Wunde, die nicht wirklich zu heilen scheint, diese rechtzeitig professionell versorgen lassen. Scheuen Sie sich also in solchen Situationen nicht, Hilfe von Experten in Anspruch zu nehmen.

E-Paper: Leben mit chronischen Wunden
Unser E-Paper "Chronische Wunden: vorsorgen, erkennen, behandeln" bietet alles Wichtige zum Thema auch noch einmal gebündelt und verständlich aufbereitet.


